Wiedereingliederung: Rechte und Pflichten
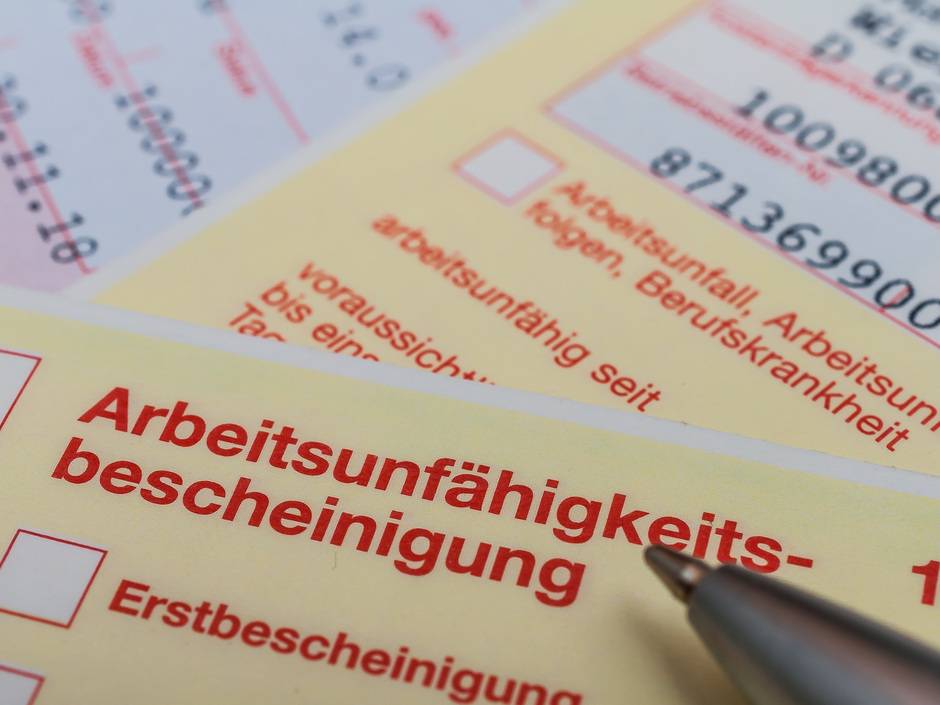
Lange Krankheit: Welche Rechte und Unterstützung gibt es?
Eine längere Krankheit kann viele Sorgen mit sich bringen – doch der Arbeitsplatz und das Einkommen sind in Deutschland gut abgesichert. Nach sechs Wochen endet die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, doch die Krankenkasse übernimmt für weitere 72 Wochen die Zahlung von Krankengeld. Wer aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit arbeitsunfähig ist, erhält stattdessen Verletztengeld von der Berufsgenossenschaft – ebenfalls über diesen Zeitraum.
Auch während einer Rehabilitationsmaßnahme muss sich niemand um seine finanzielle Absicherung sorgen. In diesem Fall zahlt meist die gesetzliche Rentenversicherung oder die Berufsgenossenschaft Übergangsgeld.
Doch was passiert nach einer langen Erkrankung mit dem Arbeitsplatz? Hier greift das Recht auf Wiedereingliederung: Arbeitnehmer können schrittweise zurück in den Beruf finden – doch wie genau funktioniert das und welche Regeln gelten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Im Handwerk besonders oft Langzeiterkrankungen
Da die Zahl der Langzeiterkrankungen unter Handwerkern steigt, erhalten sie diese Lohnersatzleistungen überdurchschnittlich häufig. Das zeigt ein von der HKK Krankenkasse erstelltes Ranking der Branchen, in denen Arbeitnehmer 2019 die meisten Tage krankgeschrieben waren. Ihm zufolge sind Langzeiterkrankungen nur unter Altenpflegern noch häufiger als bei Fachkräften aus dem Tiefbau.
Mit Bau- und Transportgeräteführern sowie der Gruppe der Maler, Lackierer und Spezialisten für die Bauwerksabdichtung sowie den Holz- und Bautenschutz landen in der Untersuchung zwei weitere handwerkliche Arbeitsfelder unter den sechs am häufigsten von langen Erkrankungen betroffenen Berufsgruppen.
Da gut jede fünfte Arbeitsunfähigkeit durch Krankheiten am Skelett- und Muskelapparat sowie immerhin 14,5 Prozent durch Lungen- und Atemwegserkrankungen verursacht werden, erstaunt dieses Ergebnis nicht. Sie werden bei handwerklichen Tätigkeiten stärker belastet als bei einem Bürojob.
Lohnfortzahlung und Krankengeld: Wann zahlt der Arbeitgeber, wann die Krankenkasse?
Doch ob im Handwerk oder anderen Branchen, die Voraussetzung dafür, dass Arbeitnehmer nach dem Ende der Lohnfortzahlung Kranken- oder Verletztengeld bekommen, ist, dass sie ihr Arzt innerhalb von zwölf Monaten sechs Wochen wegen der gleichen Krankheit arbeitsunfähig geschrieben hat.
Wer nach Ablauf der ersten sechs Wochen oder innerhalb der zwölf Monate mehrfach wegen Leiden krankgeschrieben wird, die in keinerlei Zusammenhang zueinander stehen, kann von seinem Arbeitgeber bei jeder Erkrankung verlangen, dass er den Lohn sechs Wochen zahlt. So entschied das Landesarbeitsgericht Köln (Aktenzeichen: 7 SA 454/12).
Unternehmen werden daher genau prüfen, ob es sich wirklich um eine jeweils „neue“ Erkrankung handelt. Kluge Arbeitgeber führen auch Buch darüber, wie viele Tage ein Mitarbeiter in zwölf Monaten wegen der gleichen Krankheit ausfällt. Dies kann er nachvollziehen, weil der behandelnde Arzt auf der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit angeben muss, ob er den gelben Schein erstmals ausstellt oder es sich um eine Folgebescheinigung handelt.
Ergibt die Überprüfung, dass der Mitarbeiter Folgebescheinigungen vorgelegt hat, die zusammengenommen einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen abdecken, wird das Unternehmen die Lohnfortzahlung einstellen und den Arbeitnehmer auf seinen Anspruch auf Kranken- oder Verletztengeld verweisen.
Beides zahlt die Krankenkasse Arbeitnehmern meist ohne vorherige Antragstellung. Die Kasse weiß aufgrund der ihr vorliegenden Krankschreibungen, wie lange der Arbeitnehmer bereits arbeitsunfähig ist oder es in den zurückliegenden zwölf Monaten wegen der gleichen Erkrankung war.
Wiedereingliederung und Bezahlung: Wie hoch sind Krankengeld und Verletztengeld?
Finanzielle Sorgen müssen sich Langzeiterkrankte hierzulande somit nicht machen. Kleinere Einbußen müssen sie allerdings hinnehmen. Denn das Krankengeld beträgt nur 70 Prozent ihres monatlichen Bruttolohns. Übersteigt der errechnete Betrag 90 Prozent des Nettogehalts, wird die Auszahlung bei dieser Summe gedeckelt.
Mehr verliert, wer aktuell mehr als 4.837,50 Euro verdient und damit ein Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bezieht. Er erhält dann nur 70 Prozent des Beitragsbemessungsbetrags – derzeit also 3.386,25 Euro.
Wiedereingliederung nach Krankheit: Schutz vor Kündigung
Auch Angst um den Arbeitsplatz muss sich in Deutschland niemand machen, der längere Zeit krank ist. Denn deshalb darf ihn sein Chef nur kündigen, wenn keinerlei Aussicht besteht, dass der Angestellte in absehbarer Zukunft wieder arbeitsfähig wird und sein Ausfall die Abläufe im Betrieb in einem Maße beeinträchtigt, das dem Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann.
Lesen Sie dazu auch: Notorisches Zuspätkommen, außerbetriebliches Fehlverhalten: Wann kommt die Kündigung?
Um zu verhindern, dass es so weit kommt, haben Arbeitnehmer Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen sowie das berufliche Eingliederungsmanagement (BEM), auch Wiedereingliederung genannt. Das regelt § 167 Absatz 2 des Neunten Sozialgesetzbuches. Er sieht vor, dass der Arbeitgeber Mitarbeitern, die innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen krank waren, ein Angebot zur Wiedereingliederung in den Betrieb machen muss. Nicht geregelt ist, was Gegenstand entsprechender Maßnahmen sein kann.
Stufenweise Wiedereingliederung
Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zufolge setzen Arbeitgeber und betroffene Mitarbeiter bei einem beruflichen Eingliederungsmanagement jedoch meist auf die stufenweise Wiedereingliederung, bei denen die tägliche Arbeitszeit nach einem festen Plan über mehrere Wochen kontinuierlich gesteigert wird, bis der Arbeitnehmer wieder so viel arbeitet, wie er es laut seines Arbeitsvertrags muss.
Auf Platz zwei der Maßnahmen einer Wiedereingliederung folgt die Versetzung auf einen Arbeitsplatz, an dem die Belastung geringer ist. Um dies ermöglichen zu können, steht der Betrieb sogar in der Pflicht, andere Mitarbeiter zu versetzen. Erst auf Platz drei der ergriffenen Maßnahmen folgt die ergonomische und technische Umgestaltung des ursprünglichen Arbeitsplatzes des Mitarbeiters.
Für die Wiedereingliederung denkbar sind auch eine Verringerung der Arbeitszeit oder der Arbeitsaufgaben oder eine Kombination unterschiedlicher Maßnahmen. Sollte sich während der Umsetzung der Wiedereingliederung herausstellen, dass die gewählten Lösungen den Arbeitnehmer gesundheitlich nicht ausreichend entlasten, müssen sein Chef und er Alternativen suchen.
Meist führt die Wiedereingliederung dann aber zum Erfolg. Laut einer Studie des Bildungswerkes des Deutschen Gewerkschaftsbundes verbleiben im Schnitt über 90 Prozent der Betroffenen nach einem BEM in ihren Betrieben.
Wiedereingliederungsgespräch: Rechte, Pflichten und wichtige Tipps
Arbeitnehmer verlieren also nichts, wenn sie nach einer längeren Erkrankung der Einladung ihres Arbeitgebers zu einem Gespräch über ihre Wiedereingliederung in den Betrieb folgen. Zumal sie selbst entscheiden, ob der Betriebsrat oder - falls vorhanden - die Schwerbehindertenvertretung an dem Gespräch teilnehmen sollen, oder sie sich von einem Vertreter der Berufsgenossenschaft, Renten- oder Krankenkasse begleiten lassen wollen.
Viel verlieren, kann dagegen, wer die Einladung ausschlägt oder die gemeinsam gefundenen und beschlossenen Maßnahmen der Wiedereingliederung später verweigert. Wer dann von seinem Chef gekündigt wird, hat schlechtere Chancen, sich dagegen gerichtlich zu wehren.
Wiedereingliederungspflicht für Arbeitgeber: Kündigung ohne BEM riskant
Ähnlich schlechte Karten haben Arbeitgeber, die Mitarbeiter krankheitsbedingt kündigen, ohne ihnen zuvor ein berufliches Eingliederungsmanagement (BEM) angeboten zu haben. Sie müssen dann vor Gericht beweisen, dass sie alles getan haben, um den Arbeitnehmer weiter beschäftigen zu können und dies selbst mit einer Wiedereingliederung nicht möglich gewesen wäre.
Das Bundesarbeitsgericht hat dabei 2014 sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Beweise festgelegt, die Arbeitgeber in solch einem Fall vorlegen müssen (Urteil des BAG vom 21.11.2014, Aktenzeichen 2 AZR 755/13). Können Unternehmen diese Beweislast nicht erfüllen, gehen Richter davon aus, dass es mildere Mittel als die Kündigung gegeben hätte. Sie erklären diese daher für ungültig.
Auf die stufenweise Wiedereingliederung gibt es keinen Rechtsanspruch
Da die stufenweise Wiedereingliederung nach dem sogenannten „Hamburger Modell“ die bei einem BEM am häufigsten gewählte Maßnahme ist, wird beides oft fälschlicherweise gleichgesetzt. Während Arbeitnehmer jedoch in jedem Fall einen Rechtsanspruch auf ein berufliches Eingliederungsmanagement haben, regelt § 44 des neunten Sozialgesetzbuches die stufenweise Wiedereingliederung lediglich als Soll-Vorschrift. Denn damit die Maßnahme umgesetzt werden kann, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein.
So muss sie der behandelnde Arzt befürworten. Gemeinsam mit dem Erkrankten erstellt er einen Stufenplan für die Wiedereingliederung, nach dem die Arbeitszeit am bisherigen Arbeitsplatz des Angestellten im Verlauf eines definierten Zeitraums in einer festgelegten zeitlichen Abfolge stundenweise so lange gesteigert wird, bis der Arbeitnehmer seine volle Arbeitsfähigkeit wiedererlangt hat.
Diesem Vorgehen müssen sowohl der Arbeitnehmer, wie sein Arbeitgeber, der Arzt und die Krankenkasse zustimmen. Sie alle unterschreiben den Stufenplan und begründen damit ein eigenes Rechtsverhältnis, während dessen das eigentliche Arbeitsverhältnis ruht.
Wiedereingliederung und Urlaub: Kein Anspruch während des Hamburger Modells
Die Beteiligung der Krankenkasse ist dabei erforderlich, weil der Arbeitnehmer während der stufenweisen Wiedereingliederung rechtlich nach wie vor krankgeschrieben ist. Er erhält weder sein Gehalt von seinem Arbeitgeber noch hat er Anspruch auf Urlaub. Vielmehr bekommt er während der Maßnahme Kranken- oder Verletztengeld. Er muss zu Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung daher auch noch Anspruch auf entsprechend lange Zahlung der Lohnersatzleistung haben.
Wichtig ist auch, dass die berechtigte Aussicht darauf besteht, dass der Arbeitnehmer am Ende der stufenweisen Wiedereingliederung wieder voll arbeitsfähig ist. Denn wenn er während der Maßnahme seine Arbeit an sieben Tagen nicht ausüben kann, gilt die Wiedereingliederung als gescheitert.
Lesen Sie auch: Darf man wegen Krankheit gekündigt werden?









