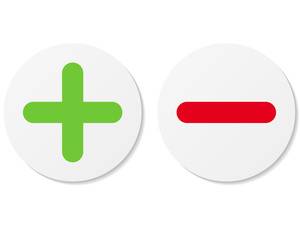Ein Plädoyer für die Erdwärme

Trotz der vielfältigen Vorteile von Sole/Wasser-Wärmepumpen (auch als Erdwärmepumpen bezeichnet) verzeichnet der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) rückläufige Umsatzzahlen in diesem Segment. Dabei sprechen zahlreiche Argumente gerade im Hinblick auf Sicherheit, Effizienz, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit für die Nutzung von Erdwärme.
1. Schutz vor Diebstahl und Beschädigung
Im Gegensatz zu außen aufgestellten Kompakt-Luft-Wärmepumpen oder den Außeneinheiten von Luft-Split-Wärmepumpen stehen Erdwärmepumpen in der Regel im Gebäudeinneren. Als der Wärmepumpenmarkt vor etwa zwei Jahren nahezu leergefegt war, kam es mehrfach zu Diebstählen von Außengeräten – Sole/Wasser-Wärmepumpen waren hiervon nicht betroffen.
2. Sicherheit bei Unwettern
Bei orkanartigen Stürmen kann selbst eine 550 kg schwere Luft/Wasser-Wärmepumpe umgestoßen und schwer beschädigt werden. Ein dokumentierter Fall führte zu einem Totalschaden mit Schadenersatzforderungen von über 30.000 Euro gegenüber dem Errichter.
3. Gefahren bei Stromausfall im Winter
Luft/Wasser-Kompaktwärmepumpen können bei Stromausfall und niedrigen Außentemperaturen einfrieren. Gelangt Wasser in den Kältekreislauf, droht ein Totalschaden. Außen aufgestellte Wärmepumpen sind zudem nicht durch die Gebäudeversicherung abgedeckt – es sei denn, es besteht eine gesonderte Versicherung.
4. Netzengpässe und § 14a EnWG
Ab dem 1. Januar 2025 dürfen Wärmepumpen laut § 14a EnWG bei Engpässen auf 4,2 kW elektrische Anschlussleistung gedrosselt werden. Da Luft/Wasser-Wärmepumpen meist monoenergetisch mit Heizstab betrieben werden, liegt deren Leistungsaufnahme auch im Ein- und Zweifamilienhaus häufig über dieser Grenze. Sole/Wasser-Wärmepumpen hingegen arbeiten meist monovalent und bleiben mit Anschlusswerten unter 4,0 kW von dieser Regelung verschont.
5. Lärmbelästigung vermeiden
Trotz technischer Verbesserungen kommt es bei Luft-Wärmepumpen weiterhin zu Nachbarschaftsbeschwerden. Hellhörige Nachbarn fühlen sich durch Betriebsgeräusche gestört. Bei Split-Wärmepumpen treten zudem häufig Körperschallübertragungen ins Gebäude auf – insbesondere über die Heißgasleitung.
6. Effizienz unabhängig von Außentemperaturen
Sole/Wasser-Wärmepumpen nutzen die nahezu konstante Temperatur des Erdreichs und bieten daher eine gleichbleibend hohe Effizienz. Luft/Wasser-Wärmepumpen hingegen verlieren bei sinkenden Außentemperaturen an Heizleistung und Wirkungsgrad. Ihre Einsatzgrenzen liegen typischerweise zwischen -20 °C und +35 °C.
Kostenentwicklung und alternative Erdwärmequellen
Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der Einführung großzügiger Förderungen stiegen die Preise für Erdsondenanlagen zwischenzeitlich stark an. Mittlerweile bewegen sich die Kosten wieder nach unten – eine Entwicklung, die vielen Energieberatern, Installateuren und Bauherren noch wenig bekannt ist.
Zudem existieren zahlreiche alternative Varianten zur Erdwärmeerschließung: Grabenkollektoren, Erdwärmekörbe, Erdwärme-Zäune, Eisspeicher, Regenwasserzisternen, Bohrpfähle mit integrierten Wärmeübertragern, Kollektormatten und Betonabsorber. Diese Systeme lassen sich flexibel kombinieren und an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.
Erschließungskosten durch Eigenleistung senken
Durch Eigenleistungen bei der Verlegung von Flächenkollektoren lassen sich die Erschließungskosten um bis zu 50 % im Vergleich zu Erdsondenanlagen reduzieren. Bei guter Auslegung regenerieren sich Flächenkollektoren außerhalb der Heizperiode jedes Jahr vollständig.
PVT-Kollektoren als ergänzende Wärmequelle
Photovoltaisch-thermische Kollektoren (PVT) gewinnen an Bedeutung – besonders in milden Klimazonen. In Kombination mit Flächenkollektoren sind sie auch in kälteren Regionen einsetzbar. Voraussetzung ist ein professionelles Quellenmanagement, für das es mittlerweile spezialisierte Anbieter gibt.
Herausforderungen bei Erdsonden im verdichteten Wohnbau
Wegen fehlender Flächen wird im Reihenhausbau oft auf Erdwärmenutzung verzichtet. Häufig befindet sich nur hinter dem Gebäude Platz für die Bohrtechnik. Der Krantransport über das Haus hinweg gilt als teuer und kompliziert. Gleichzeitig ist der rückwärtige Bereich bei vielen Gebäuden aus schallschutztechnischer Sicht problematisch – denn dort liegen häufig die Schlafzimmer.
Grunddienstbarkeit als Lösung
Weniger bekannt ist die Möglichkeit, eine Grunddienstbarkeit für die Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. Gehwege) einzutragen. In Sachsen sind dem Autor zwei Fälle bekannt, in denen dies problemlos erfolgte – inklusive Genehmigung von Erdsonden mit Tiefen über 200 m.
Systeme wie die von Alpha Innotec und anderen Anbietern leiser, modulierender Sole/Wasser- Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher ermöglichen es, jede Wohneinheit mit einer eigenen Sole/Wasser-Wärmepumpe zu versorgen. Investoren schätzen diese Lösung besonders, da sie eine direkte Abrechnung über den Stromzähler und eine individuelle Temperaturregelung durch den Betreiber erlaubt.
Fazit
Sole/Wasser-Wärmepumpenanlagen in Kombination mit wassergeführten Flächenheizsystemen bieten zahlreiche Vorteile: hohe Effizienz, umweltfreundlicher, geringe Geräuschentwicklung, Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen, eine längere Lebensdauer und einen hohen Komfort mit wohliger Wärme. Gerade im Bestand mit erhöhtem Temperaturniveau sind sie Luft/-Wärmepumpen in vielen Belangen oft überlegen.
Vorausgesetzt, die wasserrechtliche Genehmigung liegt vor, ist es bei Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile die mit Abstand sicherste und beste Lösung. Die höheren Investitionskosten rechnen sich mittel- bis langfristig und werden durch die gravierenden Vorteile infolge weniger Ärger oft schon dadurch aufgewogen. Der einzig wirklich nachvollziehbare Hinderungsgrund für eine andere Lösungsvariante bleibt meist die fehlende Finanzierung.
Hans-Jürgen Seifert ist Dipl.-Ing. (FH) für Luft- und Kältetechnik. Er ist Inhaber eines Ingenieurbüros für Wärmepumpensysteme und rationelle Energieanwendung und erstellt als Privat- und Gerichtssachverständiger Gutachten zu Wärmepumpenheizungsanlagen. Er ist außerdem Autor mehrerer Sachbücher.